|
Infektionen mit Endoparasiten spielen bei Pferden eine große Rolle und können nicht unerhebliche Schäden verursachen. Parasiten bedingte Darmerkrankungen enden im schlimmsten Fall wegen Darmentzündung oder Kolik mit dem Tod des Pferdes. Äußerlich sind Anzeichen eines Endoparasitenbefalles meist nur geringfügig oder gar nicht zu erkennen. Es kann durchaus bereits zu einem gefährlichen Befall eines Pferdes gekommen sein, obwohl es äußerlich gesund erscheint.
Wenn es zu äußeren Erscheinungen kommt findet man generell folgende Symptome
- Stumpfes Haarkleid
- Abmagerung
- Blähbauch
- Kümmern bzw. Wachstumshemmung
- Juckreiz an der Schweifrübe
- Husten und/oder Nasenausfluss bei Lungenwurmbefall
- Kolik
- Durchfall
- Verminderte Leistungsfähigkeit
Da man den Pferden das Ausmaß des Parasitenbefalls äußerlich schwer ansehen kann, werden bisher regelmäßige Entwurmungen zur Prävention von Sekundärerkrankungen empfohlen, ohne den tatsächlichen Parasitenbefall bzw. die Notwendigkeit einer Entwurmung zu überprüfen. Bei diesem Vorgehen gehen alle Beteiligten fälschlicher Weise davon aus, dass alle Pferde in ähnlichem gesundheitsschädlichen Ausmaß mit Endoparasiten infiziert sind, was nicht stimmt. Die Widerstandsfähigkeit verschiedener Pferde gegen Parasitenbefall ist sehr unterschiedlich. Oft ist es innerhalb eines Bestandes so, dass nur 20-30% der Individuen 80% der Würmer beherbergen, der Rest ist nicht maßgeblich befallen.
Die derzeitige Praxis der Endoparasitenbekämpfung könnte man mit folgendem Szenario vergleichen: Ein Pferd im Bestand fängt sich eine bakterielle Infektion ein und muss mit einem Antibiotikum behandelt werden. Darauf hin werden alle andern Pferde des Bestandes ebenfalls antibiotisch behandelt, ohne zu wissen ob sie infiziert sind oder nicht. Dies würde kein vernünftiger Mensch tun. Aber genau das tun wir mit der derzeitigen Entwurmungspraxis.
Das korrekte Vorgehen wäre zuerst die Notwendigkeit bzw. das Ausmaß des Parasitenbefalls zu untersuchen und nur gezielt die Pferde zu behandeln, die infiziert sind. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Pferde absolut parasitenfrei werden. Ein geringgradiger Befall kann aus verschiedenen Gründen sogar wünschenswert sein, auch wenn dies unserem heutigen Hygieneempfinden widerspricht.
Nun könnte der Einwand kommen, dass wir doch auch prophylaktisch gegen Infektionen impfen. Der Unterschied zwischen der ”prohylaktischen” Entwurmung und der Impfung ist, dass die Impfung der Infektion durch Immunisierung vorbeugt, die blinde Entwurmung aber eine vermutete Infektion behandeln will und somit keine Vorbeugung darstellt sondern eine Therapie auf Verdacht.
Da, wie gesagt, nicht alle Pferde in einem Ausmaß infiziert sind, dass sie eine Behandlung bräuchten, sind viele Verabreichungen von Antihelmintika überflüssig und im Sinne der Vermeidung von Resistenzbildung schädlich. Den Grad des Parasitenbefalls könnte man grundsätzlich durch Untersuchung von Kotproben überprüfen - aber da gibt es sowohl in der Durchführung wie in der Akzeptanz durch den Pferdebesitzer (es kostet Geld) Probleme.
Das “Problem” der regelmäßigen Entwurmung und die Bildung von Resistenzen:
Dachte man Ende des letzten Jahrhunderts nach der Ausbildung von Resistenzen gegen die etablierten Antihelmintika mit der weit verbreiteten Anwendung von Ivermectin und Moxydectin den Würmern endgültig Paroli bieten zu können, so sieht die Situation inzwischen ganz anders aus. Auch gegen diese beiden Wirkstoffe findet inzwischen eine Resistenzbildung statt, auch wenn sie im Fall der kleinen Strongyliden noch sehr gering ist, gegen den Spulwurm beim Fohlen sind beide Wirkstoffe inzwischen weitgehend wirkungslos.
Da die Verfügbarkeit neuer Wirkstoffe nicht in Sicht ist, könnte sich für unsere Pferde mittel- und langfristig eine bedrohliche Situation entwickeln. Nämlich dann, wenn sich gegen alle verfügbaren Wirkstoffe Resistenzen ausbilden. Eine effektive Endoparasitenkontrolle wäre dann nicht mehr möglich - mit den entsprechenden Folgen.
Die Mechanismen zur Ausbildung von Resistenzen sind kompliziert und ihre Erläuterung sprengt den Rahmen einer Informationsseite für Pferdeleute. Daher im Folgenden nur eine Aufstellung dessen, was man tun müsste, um im Sinne von Nachhaltigkeit die Resistenzbildung zu verlangsamen (unterbinden wird man sie im Fall der keinen Strongyliden nicht können).
- Behandlung mit Antihelmintika nur wenn notwendig
- Behandlung nur nach diagnostischem Nachweis einer klinisch relevanten Infektion
- Diagnose über die Untersuchung von Kotproben
- Pferde müssen nicht absolut Parasitenfrei sein
- Überprüfung der Wirksamkeit der Behandlung
- erneute Kotproben zur Überprüfung des Erfolgs der Behandlung
- Keine routinemäßige Rotation zwischen verschiedenen Präparaten sondern nur nach Resistenzlage (das hat man früher anders gesehen)
- Ausreichend lange Intervalle zwischen den Behandlungen einhalten, um den Selektionsdruck hinsichtlich Resistenzbildung zu nehmen
- Bestimmung des Körpergewichtes zur korrekten Dosierung der Wirkstoffe
- Keine Verwendung nicht für das Pferd bestimmter Wirkstoffe oder Verabreichungsformen
- Maßnahmen zur Entfernung infektiösen Materials
- Absammeln von Kot auf der Weide mindestens 2x wöchentlich (eigentlich jeden 2. Tag
- Wechselweide
Wie bei anderen wesentlich gravierenderen Problemen der Menschheit wird man die Durchsetzung dieser Maßnahmen nur dann erreichen, wenn es gesetzgeberischen Druck gibt (Der steht für Deutschland noch nicht in Aussicht). Denn es ist billiger, bequemer und wesentlich weniger aufwändig alles beim Alten zu lassen.
In sofern sind die Empfehlungen im Folgenden ein frommer Wunsch. Sie entsprechen aber dem, was von namhaften deutschen und internationalen Tierärzten vorgeschlagen wird.
Therapie von Wurminfektionen
Zur Bekämpfung von Endoparasiten gibt es eine Anzahl verschiedener Präparate, wobei keines davon das gesamte Spektrum der Parasiten abdeckt, weshalb verschiedene Präparate oder Wirkstoffkombinationen zum Einsatz kommen. Bei allen Wirkstoffen gibt es das Problem der sehr unterschiedlichen spezifischen Resistenzbildung. Beim Einsatz der Präparate gegen spezifische Erreger wird nicht mehr geraten die Wirkstoffe unbedingt zu wechseln, es sei denn die Resistenzlage begründet es. Außerdem sollte die richtige Dosierung, die über das Körpergewicht des Pferdes ermittelt wird, eingehalten werden, da eine Unterdosierung nicht nur zu einer Wirkungsminderung, sondern zu einer Resistenzbildung führen kann.
Antiparasitika: Wirkstoffe und Beispiele für Markennamen
Derzeit stehen vier Wirkstoffgruppen zur Verfügung:
1) Wirkstoffgruppe: Benzimidazole
2) Wirkstoff: Pyrantel
3) Wirkstoffegruppe: makrozyklische Laktone
Ivermectin und Moxidectin
z.B. Eraquell, Ivomec, Furexel, Equest
4) Wirkstoff Praziquantel
5) Kombination: Ivermectin + Praziquantel
Welche Wirkstoffe sind gegen welche Parasiten effektiv:
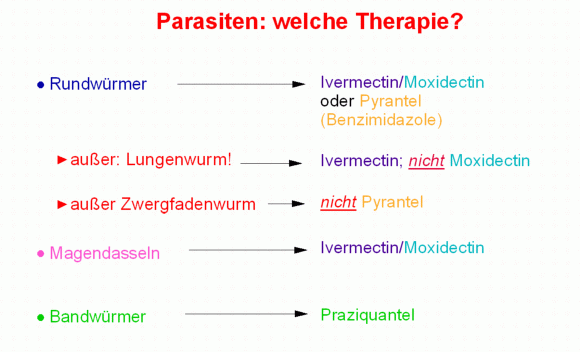
Empfehlungen zur Strategie der Endoparasitenbekämpfung
Derzeit werden folgende Empfehlungen zur Bekämpfung von Parasiten gegeben (Samson-Himmelstjerna G. et al. (2011) Empfehlungen zur nachhaltigen Kontrolle von Magen-Darminfektionen beim Pferd in Deutschland. Pferdeheilkunde 27:2, 127-139). Beachten Sie dabei auch die Spalten “Behandlung” und “Bemerkung”.
Achtung: Abweichungen nach oben und unten sind je nach Hygiene und spezifischen Gegebenheiten möglich bzw. notwendig. Bei größeren Beständen oder Gestüten raten wir dringend zu einer Beratung durch einen Parasitologen oder fragen Sie Ihren Tierarzt!
5-Jährige und ältere Pferde mit Weidegang:
|
Behandlungszeitpunkt
|
Hauptindikation
|
Wirkstoffgruppe
|
Behandlung
|
Bemerkung
|
|
1-2 Monate nach
Weideaustrieb
(Juni / Juli)
|
Kl. Strongyliden
|
Ivermectin /
Moxidectin
|
Alle Tiere der
Altersgruppe
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
August / September
|
Kl. Strongyliden
|
Pyrantel /
Fenbendazol
Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe jedoch nur wenn Befall im
Bestand nachgewiesen
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
November /
Dezember
|
Kl. Strongyliden, ggf.
Gasterophilus- Larven, Bandwürmer
|
Ivermectin /
Moxidectin
+ ggf. Praziquantel
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, Praziquantel nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen wurde
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Februar / März
|
Kl. Strongyliden
|
Pyrantel /
Fenbendazol
Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe jedoch nur wenn Befall im
Bestand nachgewiesen
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
 |
 |
|
Zur Grafischen Darstellung des Entwurmungszyklus
|
|
|
|
Fohlen:
Fohlen und junge Pferde sowie Zuchtstuten sollten nach speziellen Entwurmungsschemen behandelt werden.
|
Behandlungszeitpunkt
|
Hauptindikation
|
Wirkstoffgruppe
|
Behandlung
|
Bemerkung
|
|
Alter 4 Wochen
(ca. April / Mai)
|
Strongyloides
westeri
|
Fenbendazol /
Pyrantel / Ivermectin
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, wenn Befall im Bestand bei Monitoring nachgewiesen
|
Monitoring durch Untersuchung von
Kotproben im
Alter von 3
Wochen
|
|
Alter 2 Monate
(ca. Mai / Juni)
|
P. equorum / kl.
Strongyliden
|
Ivermectin oder
(Pyrantel / Fenbendazol) Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe
|
Monitoring durch Untersuchung von
Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Alter 5 Monate
(ca. August/September)
|
P. equorum, kl.
Strongyliden, ggf. Gasterophilus- Larven, Bandwürmer
|
Ivermectin /
Moxidectin
+ ggf. Praziquantel
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, Praziquantel nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen wurde
|
Monitoring durch Untersuchung von
Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Alter 8 Monate
(ca. November / Dezember)
|
P. equorum, kl.
Strongyliden, ggf. Gasterophilus- Larven, Bandwürmer
|
Ivermectin /
Moxidectin
+ ggf. Praziquantel
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, Praziquantel nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen wurde
|
Monitoring durch Untersuchung von
Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Alter 11-12 Monate
(ca. Februar / März)
|
P. equorum
|
Fenbendazol /
Pyrantel / Ivermectin / Moxidectin Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, wenn Befall im Bestand bei Monitoring nachgewiesen
|
Monitoring durch Untersuchung von
Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
Jährlinge und Jungpferde (bis 4 Jahre):
|
Behandlungszeitpunkt
|
Hauptindikation
|
Wirkstoffgruppe
|
Behandlung
|
Bemerkung
|
|
1-2 Monate nach
Weideaustrieb
(Juni / Juli)
|
Kl. Strongyliden,
P. equorum
|
Ivermectin /
Moxidectin
|
Alle Tiere der
Altersgruppe
|
|
|
4-5 Monate nach
Weideaustrieb (August / September)
|
Kl. Strongyliden, P. equorum
|
Pyrantel /
Fenbendazol
Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe jedoch nur wenn Befall im
Bestand nachgewiesen
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Bei Aufstallung
(November / Dezember)
|
P. equorum, kl.
Strongyliden, ggf. Gasterophilus- Larven, Bandwürmer
|
Ivermectin /
Moxidectin
+ ggf. Praziquantel
|
Alle Tiere der
Altersgruppe, Praziquantel nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen wurde
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
Februar / März
|
Kl. Strongyliden, P. equorum
|
Pyrantel /
Fenbendazol
Resistenzstatus berücksichtigen
|
Alle Tiere der
Altersgruppe jedoch nur wenn Befall im
Bestand nachgewiesen
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
Zuchtstuten:
Mutterstuten sollten aufgrund der Zwergfadenwürmer, die sich im Euter befinden und mit der Milch übertragen werden (galaktogen), nicht im letzten Monat vor der Geburt entwurmt werden, da es dadurch zu einer erhöhten Ausscheidung kommt. Empfehlenswert ist daher bis zu 6 Wochen vor der Geburt eine Entwurmung vorzunehmen und auf alle Fälle sofort nach der Geburt.
|
Behandlungszeitpunkt
|
Hauptindikation
|
Wirkstoffgruppe
|
Behandlung
|
Bemerkung
|
|
1-2 Tage nach
Abfohlung
|
Übertragung von
Strongyloides westeri auf Fohlen
|
Ivermectin /
Moxidectin
|
Jede Stute im
Bestand
|
|
|
Juli / August
|
Kl. Strongyliden
|
Pyrantel /
Fenbendazol
|
Jede Stute im
Bestand, evtl. nur wenn Befall im Bestand durch Monitoring nachgewiesen
|
Monitoring durch
Untersuchung von Kotproben (evtl. Sammelproben)
|
|
November /
Dezember
|
Kl. Strongyliden,
ggf. Gasterophilus- Larven, Bandwürmer
|
Ivermectin /
Moxidectin
+ ggf. Praziquantel
|
Jede Stute im
Bestand, Praziquantel wenn Bandwürmer im Bestand nachgewiesen wurden
|
|
Prophylaxe
Die Prophylaxe hat eine große Bedeutung bei der Bekämpfung der Endoparasiten.
Folgende Maßnahmen sollten eingehalten werden:
a) Möglichst wenig Pferde pro Fläche, um die Kontamination über den Kot zu minimieren.
b) Auf dicht besiedelter Fläche wenn irgend möglich die Pferdeäpfel täglich entfernen (mindestens jedoch 2x in der Woche .
c) Permanente Tränken (z.B. fest installierte Tränken auf der Weide) häufig reinigen.
d) Mehrere Tage vor der Verbringung eines neuen Pferdes in eine Herde eine Entwurmung des Pferdes vornehmen, wenn die Kotprobe positiv ist.
e) Die Weide von anderen Tierarten abgrasen lassen, da andere Tierarten (Schafe, Kühe usw.) keine Wirte der Parasiten sind und damit die Entwicklungskette zerstören und somit die Weide von Pferdeparasiten entseuchen.
f) Düngung mit Pferdemist auf Pferdekoppeln und Wiesen vermeiden oder vorher heiß kompostieren.
g) Eine Zufütterung der Pferde vom kontaminiertem Boden vermeiden (evtl. Futterraufe bzw. -trog benutzen).
h) Die Eier der Magendasseln, die am Haarkleid anhaften, regelmäßig entfernen, um eine orale Aufnahme zu verhindern.
k) Nach der Entwurmung die Boxen reinigen, um sämtliche Eier und infektionsfähige Larven aus der Einstreu und Boxe zu entfernen und damit eine frühzeitige Neuinfektion zu verhindern. Bei der Entwurmung abgehende Würmer sind nicht infektionsfähig.
Nachweis von Endoparasiten
Mit dem bloßen Auge sind nur wenige Endoparasiten sichtbar (Strongyliden, Oxyuris equi, Parascaris equorum, Gasterophilus-Larven). Die meisten sind nur im Mikroskop zu erkennen. Zum Nachweis müssen daher frische Kotproben in einem Labor untersucht werden. Hierbei kann nicht nur das Vorhandensein von Würmern überprüft werden, sondern eine detaillierte Analyse der Würmer vorgenommen werden, so dass eine effektivere Behandlung möglich ist. Jedoch werden nur gewisse Entwicklungsstadien der Würmer ausgeschieden, so das nicht in jeder Kotprobe Endoparasiten nachgewiesen werden können, obwohl eine Verwurmung vorliegt, wodurch eine gewisse Unsicherheit entsteht.
Bei der Untersuchung von Sammelproben wird Kot von jeweils etwa 5 Pferden zu einer Probe zusammengemixt. Bei einer Gruppe von z.B. 20 Pferden bedeutet das 4 Sammelproben von jeweils 5 Pferden untersuchen zu lassen.
Die Entnahme einer Blutprobe kann im Fall einer hochgradigen Verwurmung ebenfalls einen Hinweis auf ein endoparasitäres Problem geben. So sind dabei die Eosinophilen (ein Anteil der weißen Blutkörperchen) u. a. bei einem Endoparasitenbefall erhöht.
.
|